Was wir von Trump, Harris und TikTok über Wahlkampfstrategien lernen können
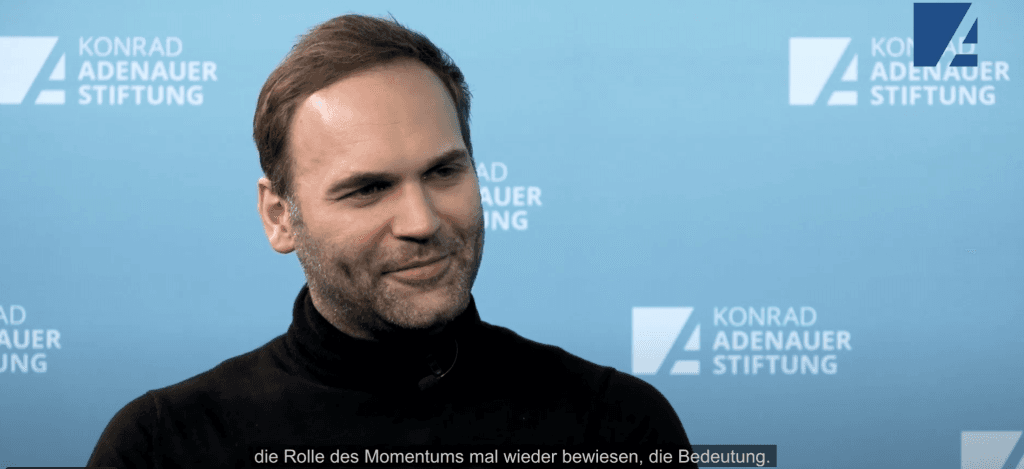
Die jüngste US-Wahl war eine historische – von einem Attentat auf einen Kandidaten bis hin zum kurzfristigen Austausch des anderen. Szenen wie Donald Trump an der Fritteuse einer Fastfoodkette oder Kamala Harris auf dem Cover der Vogue sind uns im Kopf geblieben. Doch welche kommunikativen Strategien stecken hinter diesen Momenten und dem gesamten Wahlkampf? Philipp Sälhoff, Geschäftsführer von Polisphere, beleuchtet im Gespräch mit dem Politsnack-Format der Konrad-Adenauer-Stiftung die Dynamiken des Wahlkampfs zwischen Trump und Harris.
Momentum & Rapid Response: Ein zentrales Learning ist die Bedeutung des Momentums. Der anfängliche Hype um Kamala Harris war real und spiegelte sich in Umfragen wider, doch das Halten dieses Momentums über die Distanz hinweg erwies sich als schwierig. Donald Trump zeigte sich erneut als Meister des Rapid Response, indem er Kommentare von Gegnern schnell aufgriff und ins eigene Narrativ packte – sei es mit dem Müllwagen als Reaktion auf Joe Biden oder der McDonald’s-Fritteuse nach Harris‘ Biografie. Auch die Harris-Kampagne nutzte diese Strategie, um auf Diffamierungen zu reagieren.
Mikrokampagnen & Datengetriebenes Campaigning: Obwohl es übergeordnete Kampagnen gab, waren Mikrokampagnen von entscheidender Bedeutung. In einer fragmentierten US-Gesellschaft und mit einer fortgeschrittenen Datenstruktur ermöglichten sie die Erstellung zielgruppenspezifischer Botschaften, die unter dem Dach einer übergreifenden Erzählung funktionierten. Bei Polisphere arbeiten wir intensiv mit Datenerhebung und -analysen und sehen, wie effektiv diese Technik ist, die auch in Deutschland immer wichtiger wird.
TikTok als Game Changer: TikTok war die große Neuheit in diesem Wahlkampf. Früher als Trump waren die Kampagnen von Harris und dem demokratischen Lager dort aktiv. Der Hype um Kamala Harris führte zu kreativen, popkulturellen Memes und Formaten wie „Camella is bread“ oder „Coconut tree Cat Lady“. Auch Trumps Community nutzte TikTok, um ihn als „ikonenhaften Retter des christlichen Abendlandes“ zu inszenieren. Entscheidend war dabei die Aktivität der Community und der Support von Influencern.
KI: Im Hintergrund, nicht im Scheinwerferlicht: Künstliche Intelligenz spielte primär hinter den Kulissen eine Rolle – als Hilfsmittel für Content-Generierung, Textindividualisierung und Redaktionspläne. Sichtbare Deepfakes mit großer Reichweite waren erstaunlich selten. Der hochgradig personalisierte Wahlkampf legte den Fokus auf authentische Ansprache, was KI-generierte sichtbare Inhalte weniger zielführend machte.
Internationale Akteure & Desinformation: Russland war der aktivste internationale Akteur und nutzte KI-generierte Websites, um pro-russische und anti-demokratische Inhalte im industriellen Maßstab zu verbreiten. Auch Iran und China waren aktiv, wobei der Iran Trump attackierte und China gesellschaftliche Spaltung förderte. Dennoch hatten inländische Akteure der „MAGA-Bubble“ mit Desinformation und Hate Speech einen weitaus größeren Einfluss.
Resilienz gegen Desinformation: Ein zentrales Problem ist, dass die Frage der Echtheit oft in den Hintergrund tritt, wenn Inhalte ins eigene Weltbild passen. Emotionale Botschaften, wie Trumps Darstellung als „Kämpfer gegen das System“, können rationale Rezeptionsmechanismen überlagern. Die Sensibilisierung ist wichtig, muss aber gezielt bei Gruppen ankommen, die den politischen Diskurs vorrangig über Social Media wahrnehmen.
Autor:in

